Zu Besuch bei … dem Jazzfest Berlin 2023. Ein Festivalbericht.
Nichts zum Davonlaufen
Text & Fotos: Victoriah Szirmai
Auch dieses Jahr gilt wieder: Nach dem Festival ist vor dem Festival. Hatten wir gerade noch das Glück, zwei (fast) vollkommene Abende auf dem be kind-Festival verbringen zu dürfen, ruft auch schon wieder das Jazzfest Berlin. Das geht dieses Jahr unter dem Motto „Spinning Time“ als 60. Jubiläumsausgabe – und zum mittlerweile sechsten Mal unter der Kuration von Nadin Deventer – über die Bühne. Dass man da etwas ganz Besonderes erwartet, versteht sich von selbst. Vor allem, wo die Bilanz nach vier Tagen voller Jazz letztes Jahr lautete: Alles in allem alles zu viel.
Die Zuschauerüberforderung liegt vor allem in der Struktur des Festivals selbst: Im Gegensatz zu be kind, wo man, einmal angekommen, allen Stress getrost vergessen kann, geht der hier mit Ankunft erst so richtig los: Schließlich werden zeitgleich mehrere Veranstaltungsorte bespielt, und selbst, wenn man sich einen Plan gemacht hat, was man alles sehen möchte und was nicht, trifft man zwangsläufig immer auf mindestens eine vertrauenswürdige Quelle, die einem zurät, doch auch dieses und jenes noch ansehen zu müssen, sodass man sich letztlich in einer kontinuierlichen Zerreißprobe übt.

Zwar habe ich mich sicherheitshalber mit meinem Fahrrad und einem ÖPNV-Monatsticket für selbiges ausgerüstet, um im Falle des beschriebenen Empfehlungsfalles blitzschnell à la Bike & Ride von A nach B zu kommen, doch eigentlich steht mein Entschluss fest: Ich lasse dieses Jahr die Clubs aus, auch, wenn dort – wie spätestens letztes Jahr zu sehen war – das aufregende(re) Jazzleben tobt. Kein A-Trane für mich, kein Quasimodo, ja, nicht einmal die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche! Mehr noch: Ich möchte mich löwenanteilig aufs Programm auf der Hauptbühne des Hauses der Berliner Festspiele konzentrieren und dessen Seitenbühnen, soweit möglich, außen vor lassen. Dieser Plan ist nicht nur der dringend nötigen Entzerrung der Festivaltage geschuldet, sondern auch der Musik selbst, denn tatsächlich findet dieses Jahr fast alles, was mich interessiert, auf der Hauptbühne statt. Das sehen wohl auch genügend andere so, denn der Große Saal des Festspielhauses ist nahezu restlos ausverkauft.
Pünktlich um 18:00 Uhr am Festivaldonnerstag gehen die Lichter aus. Die Eröffnungsrede beginnt mit den Worten „Everybody has the blues. Everybody longs for meaning. Everybody needs to love and be loved“, die aus einem Essay Dr. Martin Luther Kings von 1964 stammen, in welchem er die Relevanz von Jazz in der Geschichte der Bürgerrechtebewegung beschrieb. Auch im Chaos der heutigen Zeit – der Hamas-Angriff auf Israel war noch keinen Monat alt, der Angriff Russlands auf die Ukraine währte mittlerweile mehr als 600 Tage – und dem, was es psychisch und emotional mit uns mache, bestehe die Hoffnung auf die ordnenden Kräfte der Musik. Die wird hier von 220 Musiker*innen aus über 25 Ländern in verschiedenen, auch generationsübergreifenden Projekten zu hören sein. Die Altersspanne der Akteur*innen reicht von 9 bis 85 – und beide Extreme sind gleich am Eröffnungsabend zu erleben.

Doch die tatsächliche Eröffnung durch das US-amerikanische & Schweizer Duo der Pianistin Sylvie Courvoisier und der Gitarristin Mary Halvorson verläuft aber erst einmal: komplett unspektakulär. En detail wird den Zuschauer*innen zunächst ein Duett aus Saitengezupf aufgetischt, denn Courvoisier funktioniert ihr Piano zu Beginn zu einer Art überdimensionierten, waagerechten Harfe um, in deren Saiten sie beherzt hineinfasst, bevor dann irgendwann die Tasten angeschlagen werden und die Gitarre tremolierend anhebt, entfernt an spanisch-folkloristische Klänge zu erinnern, die ihrerseits wiederum sehr schnell sehr experimentell werden, wobei sich das „sehr schnell“ hier durchaus wörtlich verstehen lässt: So mancher Speed Metal-Gitarrist würde angesichts dessen, was Halvorson hier fabriziert, vor Neid erblassen, mehr noch: wäre vermutlich hocherstaunt, was sich diesbezüglich so alles aus einer so unschuldig anmutenden Akustikgitarre herausholen lässt!
Der Überraschungsmoment wird konterkariert von einem abruptem Tempowechsel, der in eine märchenhafte Klangwelt führt, verstärkt durch die rätselhaften Lichtprojektionen im Bühnenhintergrund, die gleichermaßen rauschend-irrlichternder Laubwald sein könnten als auch Engelsschwingen, welche die Musikerinnen sanft und sicher umschließen und damit, eingedenk der einleitenden Worte, Ruhe ins (Klang-)Chaos bringen. Einem Chaos, inmitten dessen sich so manches Mal nicht mit Sicherheit sagen lässt, welcher Ton von den Klavier- und welcher von den Gitarrensaiten erzeugt wird. Nach spätestens fünfundzwanzig Konzertminuten ist aber auch dieses zunächst kurzweilige Vergnügen all in all ein bisschen boring, dazu ziemlich gniedelig und klimperig, und ja, auch anstrengend. Man hat das Gefühl, die beiden spielten nur für sich allein und hätten ihr Publikum, das den gegenseitigen musikalischen Jokes nicht folgen kann, völlig vergessen. Die Wirkung ist die eines dauernörgelnden Dreijährigen zum Feierabend, wenn man doch einfach nur seine Ruhe haben will. Aber wie sagte Kuratorin Deventer schon vor einigen Jahren im Interview? No more Wohlfühlprogramm! Auch die Zugabe, Monty Pythons „Silly Walk“, ändert daran nicht viel – macht aber erstmal wieder wach.
Nach einer sehr kurzen Pause, in der man ob der langen Warteschlangen an der Bar sein Kartoffel-Pastinaken-Süppchen (lecker!) und den Dickes B.-Roten (mit Mühe akzeptabel) mehr oder minder hinunterschlingen bzw. -stürzen muss, wartet der Höhepunkt des ersten Festivaltages – und zwar in Form einer im Auftrag des Jazzfestes Berlin vom Pariser Ensemble Novembre entwickelten Adaption seiner „Apparitions“, in der die modularen Bebop-Stücke des Quartetts durch Cello-Trio, ein weiteres Trio namens Bribes sowie 30 Vokalist*innen aus Berliner Kinderchören neu interpretiert werden. Da für diese Aufführung die eingangs angekündigten Neunjährigen erwartet werden, ist der Saal merklich unruhiger, haben sie doch neben ihren Erziehungsberechtigten gefühlt auch all ihre Geschwister und Freund*innen sowie alle weiteren Bestandteile der modernen Berliner Patchworkfamilie mitgebracht. Für das Stück, das von Deventer als „eigentliches Eröffnungsstück des Festivals“ bezeichnet wird, haben die Kinder von Montag bis Donnerstag im Festspielhaus geprobt. Außerdem sind dreißig weitere Kinder im Haus zu Gast, die zwar nicht auf der Bühne zu sehen sind, aber am Impro-Camp des Festivals teilgenommen haben, was einmal mehr die Klassenfahrtatmosphäre erklärt, die von hinter den Kulissen jetzt den Zuschauersaal flutet.

Novembre um Saxophon-Frontmann Antonin-Tri Hoang und Pianist Romain Clerc-Renaud erlauben sich erst einmal einige musikalische Späße, indem sie Stücke, die sich als Fünf- bis Zehnsekünder erweisen, ausführlich ankündigen. Dann wird es stockdunkel, irgendwo hinten im Raum erklingen schräge Celli im Wechsel mit mal kompromisslos free-en, mal hochmelodischen Intermezzi des Quartetts, die sich ins Epische entwickeln würden, ließe man sie mehr als nur wenige Sekunden frei – doch der Deckel wird immer gleich wieder auf den Topf gepresst, kaum entweicht auch nur die Andeutung thematischen Dampfes. Das fühlt sich an, als würde man ein Konzert durch den Mixer jagen, wie Klang-Snippets, die entstehen, wenn man eines ersten Eindrucks halber im Schnelldurchlauf durch ein Album zappt – nur, dass man hier nicht bei einem Titel hängenbleiben kann, wenn er anfängt, zu gefallen und man gern mehr hören würde.
Die rotlichtgeflutete Tür zum Garderobenflur öffnet sich, um Bribes gleich einem surrealen Echo der Hauptbühnenquartetts ins Spiel zu bringen. Selbiges gilt für die Streicher, die sich dank eines Spotlights jetzt etwas genauer verorten lassen. Eine vierte Klang-Dimension gesellt sich in Form der Kinderchöre hinzu, die auf die ersten Reihen des Ranges verteilt sind und von dort oben, anders lässt es sich nicht beschreiben, zu zwitschern beginnen. Das Vokale findet seine Verstärkung durch Bribes-Sängerin Linda Olah, deren angenehmen Mezzo die Kids in Form chorgewordener Obertöne in schwindelerregende Höhen heben. Das klingt: surreal. Im Wortsinne. Überwirklich. Als sie dann anheben, mit den Freejazz-Elementen des Quartetts eine Art Call & Response anzustimmen, hat das was von Fußballfans im Stadion. Vorausgesetzt, deren Grölen käme aus dünnen, hohen Engelskehlen.
Würde man sich das hier auf Platte anhören? Mit Sicherheit nicht. Mittendrin in dieser quadrophonen Performance zu sein, macht aber einen Heidenspaß! Da die Aufführenden beständig ihre Plätze wechseln, weiß man irgendwann gar nicht mehr, wo man bestimmte Klänge verorten soll. Und wann ist eigentlich dieser zweite Schlagzeuger aufgetaucht, der das Quar- zum Quintett macht? War der von Anfang an dabei? Verwirren kann einen die „Apparitions“-Adaption in jedem Falle vortrefflich mit ihren Klängen, die aus jeder Ritze des Saals (und dabei immer wieder aus einer anderen!) hervorzuquellen scheinen! Kein Wunder, hat sie sich doch auf die konzeptuelle Fahen geschrieben, das Festspielhaus zu einer Kulisse „für eine musikalische Dramaturgie des Erscheinens und Verschwinden“ zu machen. Verstärkt wird das Verwirrspiel, als die Kids beginnen, mit Taschenlampen umherzuirrlichtern. So muss es sich anfühlen, auf hoher See in Nebeldickicht zu geraten! Ich selbst rate nur, wo ich den Bleistift für meine Notizen ansetzen muss, denn bis auf einige spärliche Lichteffekte ist es wieder stockdunkel im Saal. Plötzlich scheint die Band eine weitere Band im Rücken zu haben, die Höllengestöhn produziert, was allerdings auch dem Elektrofuhrpark Clerc-Renauds entströmen könnte. Kurz: Man weiß gar nichts mehr. Und das fühlt sich ziemlich gut an.

Auflösung: Da steht tatsächlich eine zweite Band. Beziehungsweise, Bribes haben im Schutze der Dunkelheit einen Platz auf der Bühne hinter Novembre erobert. Nur sieht man sie aus der ersten Reihe des Parketts nicht. Jedenfalls ist hiermit auch das Auftauchen des Phantom-Schlagzeugers geklärt. Auch den Kinderchor zieht es – wie vor ihm schon die Celli – jetzt auf die Hauptbühne, wo es mit einem Mal ziemlich eng wird. Wieder echot er die Bribes-Vokalistin, diesmal allerdings frontal. Das kostet zwar den akustischen Verzögerungseffekt, ergibt aber spätestens dann ein wirklich schönes Bild, wenn sich die Kinder über die gesamte Bühnenbreite verteilen. Auf dem Boden sitzend schauen sie zunächst die Musiker, dann ihr Publikum an. Manche scheinen gebannt, andere zupfen an ihrer Kleidung, ihren Notenblättern oder ihrem Instrumentarium herum. Insgesamt ist es eine friedliche, ja: auch unschuldige Szenerie, die einem alten Gemälde entsprungen sein könnte.
Während der Fokus auf dem Bühnenbild liegt, haben sich Novembre-Saxophonist Antonin-Tri Hoang und sein Bribes-Instrumentalgenosse Geoffrey Gesser tief in den Saal hineingearbeitet, wo sie von rechts bzw. links, jeweils vom eigenen Schlagzeuger rührtrommelsekundiert, ihre Instrumente aufheulen lassen. Gesser gibt den Rattenfänger, die Kids laufen ihm hinterher, während sie seine Phrasen echoen. Im Schlussbild erklingt eine – tausendfach repetierte – „Sing es noch einmal“-Zeile, aufgegriffen von der Band, feierlich untermalt von den Celli, nach Hause gebracht von dem anstatt Tönen lediglich noch Lufthauch produzierenden Hoang, bevor er sich noch eine winzige Exkursion ins Freie gönnt, auf die sein Quartett voll einsteigt, um aus der Stippvisite einen Tagesausflug zu machen, der bis in die hereinbrechende Dunkelheit dauert, wo engelsgleiche Zwielichtwesen warten, bevor sie, den Zuhörer an der symbolischen Hand gefasst, leise summend entschwinden. Für Spektakel exakt dieser Art hat man solche Festivals! Toll.
Der Abend ist an einem dieser Punkte angelangt, wo man ob der soeben erlebten Intensität eigentlich nichts mehr braucht bis auf ein Taxi nach Hause. Keine Interaktion mit nichts und niemandem, weder Menschen noch Musik noch Essen noch Trinken noch Stadt. Kurz bin ich versucht, das Festival und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und nach Hause zu gehen. Aber ach! Die clevere Cliffhanger-Kuration sieht zum Abschluss des Abends die Weltpremiere von „Four Hands Piano Pieces“ durch Aki Takase und Alexander von Schlippenbach vor. Das muss man natürlich gesehen haben! Während ich in der Pause noch völlig geschafft mit farblich passendem Hopfenkaltgetränkeschaum in der dieses Jahr dankenswerterweise aufgestellten, weißen Sofalandschaft hänge, wuseln die Kleinen nach ihrem Auftritt aufgeregt durch die Entspannungslandschaft: Guck mal Moritz, ich hab die iPads gehackt!
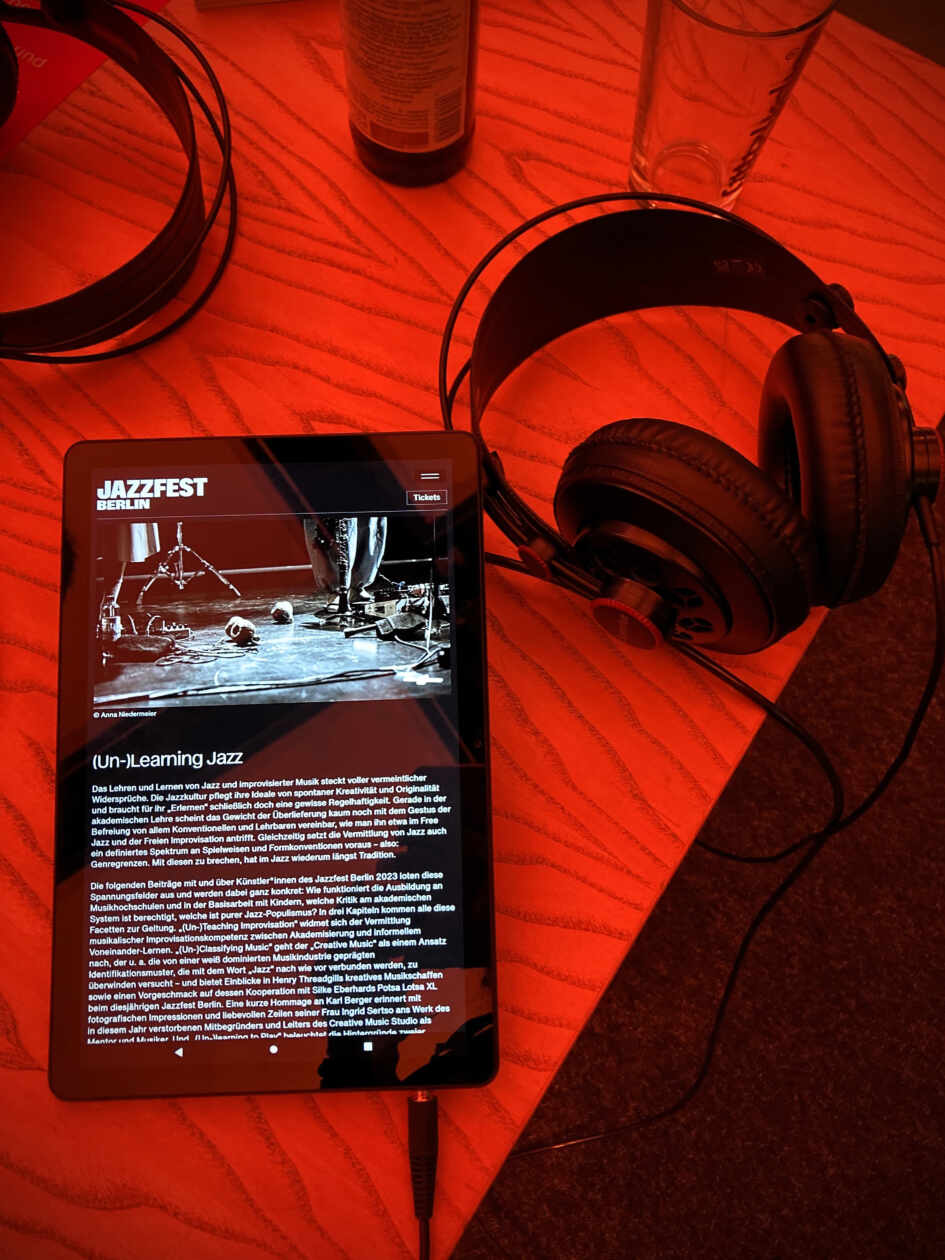
Nachdem wir wieder unsere Saalplätze eingenommen haben, kommt Deventer erneut auf die Bühne, um ob des gehörigen Gewusels auch hinter der Bühne erst einmal den Stoßseufzer „Puh, ihr könnt euch vorstellen, ich bin total erledigt!“ auszustoßen. Können wir. Wir nämlich auch.
Darum nun zu something completely different. Aki Takases erste Jazzfest-Performance von 1981 liegt 42 Jahre zurück, von Schlippenbach debütierte 1966 auf der Festival-Bühne – und nun steht das Berliner Pianistenpaar gemeinsam hier, um das Motto „Spinning Time“ mit Leben zu füllen. Und natürlich mit Klängen. Im Festivalobergeschoss, ja, das ist dort, wo die weißen Sofas locken, gibt es Screens mit den alten Performances, die dort in Dauerschleife laufen. Das „Dreamteam des Free Jazz“ indessen ist nicht hier, um nostalgisch zu sein, sondern um sein brandneues Album zu präsentieren. Das läuft unter dem Namen AAPD, einem Akronym für das Aki (Takase) und Alexander (von Schlippenbach) Piano Duo, und trägt wie das heutige Programm den schlichten Titel „Four Hands Piano Pieces“. Während Takase bei Kompositionen wie „Steinblock“ oder „Dialog“ ihre Tastatur durchaus mal mit den Ellenbogen traktiert, geben von Schlippenbachs schwere Akkorde Tempo und tonale Basis vor, sind, um im Bild zu bleiben, eher der solide Block, während Takases Töne der Steinschlag sind, der auf ihn herniedergeht.

Der jüngst verstorbenen Carla Bley erweist Takase solo mit einer Interpretation von „Ida Lupino“ die Ehre, während sich der Solopart von Schlippenbachs aus mehreren kurzen Stücken zusammensetzt, die den Kopf, wie sie so in den Tiefen gründeln, angenehm aufräumen. Beim Duett „Zwei“ legt Takase die Walking-Bass-Basis, während ihr Ehemann filigrane Tupfer setzt, bis die vier Hände zu einer einzigen zu verschmelzen scheinen, die eben zufälligerweise zwanzig Finger hat. Man wechselt gemeinsam an nur einen der beiden Flügel und spielt tastaturteilend „Nearly Yours“, das vorsieht, dass sie unten und er oben spielt, wobei sie sich gegenseitig so manches Mal recht beherzt ins Register greifen, was jetzt anzüglicher klingt, als es gemeint ist. Es folgt etwas, das von Schlippenbach ankündigt als etwas, worüber sie sich „auseinandersetzen“ hätten müssen, weshalb es nun den Titel „Zankapfel“ trage. Sie greift dabei mit links Bassdrum-artig in die Saiten, sodass ihre Rechte klingt wie ein Spinett, während er unpräpariert spielt. Bei den Proben, lacht er, sei es beinahe zur Scheidung gekommen.
Man tauscht die Plätze für ein Stück namens „Bachfactory“, dem für vier Hände bearbeiteten „Präludium“ aus dem Wohltemperiertem Klavier, durch das beide in zunehmend irrwitzigem Tempo jagen, sodass der vielbemühte Begriff vom furiosen Finale an dieser Stelle voll und ganz gerechtfertigt wäre, würde er nicht durch eine Zugabe abgemildert werden, zu der das völlig aus dem Häuschen geratene Publikum das Pianistenpaar nachgerade nötigt. Wohlgemerkt, von Schlippenbach ist 85. Wer jetzt noch kann, bleibt zum Nachtprogramm auf der Seitenbühne. Ich kann nicht und fahre nach Hause.

Es ist Freitag und damit Tag zwei des 60. Berliner Jazzfestes. Schon um 17:30 Uhr betritt Nadin Deventer die Festivalbühne und spricht über den emotionalen Abschied der Kinder, welche die letzten fünf Tage (und Nächte) im Festspielhaus verbracht haben. Tatsächlich ist eine beeindruckende Stille ins Haus eingezogen. Die ist auch nötig, denn auf dem heutigen Programm steht Delikates: Die Geigerin und Thereminspielerin Nancy Mounir hat die mikrotonale Musik ägyptischer Sängerinnen (und mit ihren sexuellen Identitäten spielenden Sängern) der 1920er-Jahre erforscht, welche nach der Zensureinführung durch den männerdominierten Kongress für Arabische Musik von 1932 beinahe völlig aus dem kollektiven Kulturgedächtnis gelöscht wurde. Ihr Projekt „Promenade Of Souls“ widmet sich in einer audiovisuellen Performance Künstlerinnen wie der Herrengarderobe tragenden Diva Mounira El Mahdeya, deren einziger Film verb(r)annt wurde. Die ausgegrabenen Originalaufnahmen im typischen Zwanzigerjahresound werden von einem Live-Orchester auf der Bühne wiedergegeben, während eine Präsentation Zeitdokumente sowie die als Überraschung angekündigten Übersetzungen der Liedtexte zeigt.
Diese überraschen allerdings nicht durch ihre Modernität oder Freizügigkeit, wie man jetzt hätte denken können, sondern zunächst dadurch, dass sich die englische Untertitelprojektion nach zwei Zeilen verabschiedet hat. Worüber El Mahdeya sang, wird ihr Geheimnis bleiben. Glücklicherweise haben sich die Untertitel schon beim nächsten Song erholt. Dieser stammt von Saleh Abdel Hagy, der ausschließlich Hochzeitssänger war, was bedeutet, dass er keine öffentlichen Konzerte spielte und eine Aufnahme mit ihm echten Seltenheitswert besitzt. Sänger Abdel Latif El Banna dagegen fällt damit auf, dass er zunächst in der Garderobe eines Scheichs auftrat, bevor er sich für den westlichen Gentlemen-Look entschied. Fatma Serry wiederum hat als erste „Eastern Lady“ in Ägypten ihre Memoiren publiziert, darin enthalten die Geschichte über ihren wohlhabenden Liebhaber, dessen Anwälte die der Affaire entsprungene Tochter „um ihr Recht brachten, den Namen ihre Vaters zu tragen“. Alle Songs werden immer mit Einblicken ins Leben und Wirken ihrer Protagonist*innen verbunden. Es gibt Filmaufnahmen, wo diese selbst zu Wort kommen, historische Fotos, Notizen, Plattenhüllen. Es ist jedoch nicht nur für musikhistorisch Interessierte ein schönes Projekt – auch die Musik wird all jene begeistern, die es langsam und nächtlich lieben, vintage und orientalisch.
In der Pause wartet ein sehr fruchtiges, leicht pikantes Kürbissüppchen, bevor Art-Rock-Urgestein Fred Frith vor allem viel Lärm verspricht, sodass ich nicht wirklich sicher bin, ob ich mir davon meinen schönen Vintage Cairo-Flow zerstören lassen soll. Man kann ja mal reingucken, rede ich mir selbst Mut zu, schließlich ist der Große Saale des Festspielhauses kein Gefängnis. Man kommt nach Konzertbeginn zwar nicht mehr rein – raus kann man aber jederzeit. Rückblickend bin ich froh, geblieben zu sein, denn nach einem ziemlich krawalligen Auftakt lärmt des barfüßigen Briten „Laying Demons to Rest“-Programm, das er mit Susana Santos Silva an der Trompete und Mariá Portugal an den Drums zum Besten gibt, gar nicht mehr so sehr. Im Gegenteil, es ist schon fast als meditativ zu bezeichnen, als hätte das entspannte Leben im kalifornischen Exil inklusive dezent psychedelischem Stoner Rock auf den Henry Cow-Mitbegründer abgefärbt. Dessenungeachtet verlässt der erste Mensch den Saal. Dem Jazzfest Berlin gelingt es also immer noch, derart unkomfortabel zu sein, dass ihm das Publikum inmitten der Musik davonläuft.
Dabei ist diese hier tatsächlich vergleichsweise wohlfühlprogrammig: Die Trompete pustet heiseren Lufthauch, das Schlagzeug läutet zwei Kuhglocken, was angenehm ländlich-idyllisch tönt, und Frith selbst bearbeitet seine quer über dem Schoß liegende Gitarre mit einem Bogen, wodurch die klingt wie eine singende Säge. Nichts zum Davonlaufen! Portugal hat indessen zu zwei Würfeln gewechselt, die Schafslaute von sich geben, Santos Silva tschilpt dazu, und Friths Steel-Pedal-artiges Sliding kann man mit ein bisschen gutem Willen als retro-avantgardistischen Bluegrass lesen bzw. hören, bevor er die Saiten und den Korpus seines Instruments mit einem Malerpinsel bearbeitet, wodurch das Trio mit einem Mal zwei Schlagwerker hat. Eine Art Karawanen-Groove entsteht, der einlullt und selbst, als es dann doch noch einmal richtig laut wird, nichts von seiner wogenden und wiegenden Wirkung einbüßt, die durch Portugals zarten Gesang, der vor diesem Hintergrund nachgerade maurisch wirkt, noch verstärkt wird. Auch der allerletzte Dämon findet nun Ruhe in feinziseliertem Wachtraumgewaber, das plingt und plätschert wie eine Meditations-CD für den Haushalt mit Geschmack. Friths zwar unverständliche, dank Märchenonkelstimme nichtsdestoweniger beruhigende Vokalisen lullen ebenso ein wie Santos Silvas mittlerweile gedämpfte Trompete und Portugals softes Klackern, das dem Knistern eines Feuers nicht unähnlich ist. Eines Feuers, das noch einmal auflodert und alles mitreißt, um es dann dissonanzenreich zu verschlingen. Jetzt fühle ich mich geläutert.

Dennoch spare ich mir den nächsten Programmpunkt – offensichtlich zu Recht, denn nach Expertise eines kurz hereinschnuppernden Musikers, der im Festivalverkauf auch noch auf der Bühne stehen wird, klingt die Berlin-Premiere von „Circus“, einem Projekt des norwegischen Schlagzeugers Paal Nilssen-Love, „like a garage band“. Da man auch auf der Pausenlandschaft via Monitorübertragung das Geschehen im Saal verfolgen kann, beschließe ich: Mir entgeht nichts. Zudem muss ich meine Kräfte schonen, denn der heutige Höhepunkt liegt beim Spätprogramm. Ich blättere in den ausliegenden Publikationen wie jener zur „Jazzvermittlung und Demokratieförderung“, das ein Kollektiv von sogenannten Jazzpilot*innen in Kooperation mit der Deutschen Jazzunion und der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben hat – nicht zuletzt, weil die Broschüre Anfang des Jahres einen unter dem bissigen Titel „Bruchpilot*innen“ erschienenen Verriss erfahren hat. Leider ist die Zeit zu kurz, die neugierig machende Kritik auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen – und am nächsten Tag hat sie schon bei einem anderen Interessenten ein zu Hause gefunden, kurz: Sie ist weg.

Das ist jetzt aber erst einmal egal, denn das Großprojekt „Sonic Dreams: Chicago“ lädt das Publikum nach einer Umbaupause ein, die Bühne zu betreten, um unmittelbar in die sphärischen Klänge der Chicagoer Jazz-Szene eintauchen zu können. Diese wird von drei Acts und aus ihnen spontan entstehenden Pop-Up-Gruppen repräsentiert: dem mit Gimbri, Harmonium, Bassklarinette, Percussion und Tenorsaxophon interessant besetzen Quintett Natural Information Society, dem sich lokale Musiker*innen, darunter Trompeter Axel Dörner, anschließen. Dem Spoken-Word-Sextett The Separatist Party, das hier seine Deutschlandpremiere erlebt. Und dem Tasten-Trio Bitchin Bajas, das die Meute mit kosmischen Synthesizer-Trips in die Nacht entlässt.
Tag drei, der Festivalsamstag, beginnt mit einer Neuerung: Die ersten beiden Sets werden ohne Pause hintereinander wiedergegeben, denn pünktlich um 20:03 Uhr nach Nachrichten und Wetter wird das dritte Konzert live im Radio übertragen. Die belgische Improvisationspianistin Marlies Debacker beginnt den Abend im Stehen – und einem aufregenden Kleid, mit dem man in alten Filmen das klassische „Blonde Gift“ ausgestattet hätte. Während sie mit der Rechten die Tastatur rührt und mit der Linken die Saiten, zieht ihr minimalistisch-fragiler Sound leise durch den Saal, und selbst, als sie dann auf der Klavierbank Platz nimmt, um die Tasten mit beiden Händen kraftvoll zu bearbeiten, ist kein Unterschied im zarten Klangbild zu vernehmen. Es sind die ganz hohen Töne der Klaviatur, die es Debacker im ersten Drittel ihres halbstündigen Sets angetan haben, bevor sie sich allmählich in die mittleren und letztlich auch die alleruntersten Tiefen hinein- bzw. hinabarbeitet. Es ist schön, wenn sich jemand trotz der limitierten Zeitvorgabe so viel Muße lässt, seine Themen zu entwickeln, ihnen Raum zu geben und nachzuspüren! Angeblich soll das in halbstündigen Konzerten ja nicht funktionieren, weshalb es Unsitte geworden ist, die Musiker*innen anzuhalten, eine Zupacknummer auf die nächste folgen zu lassen, nie innezuhalten, nie nachzulauschen, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Auf der diesjährigen jazzahead! hatte mich dieses Vorgehen beim Set von Olga Reznichenko sehr desillusioniert, war von der aus langsamer Entwicklung entstehender Magie der Platte auf der Bühne doch nichts mehr übrig!
Dass es anders geht, beweist Debacker an diesem Abend, die ihre so behutsam aufgespürten Tiefen mittlerweile mit beidseitigen Prankenhieben bearbeitet, bis eine Art Weißes Rauschen entsteht, unter dem es abgründig brodelt. Dann wieder ist die Stille Protagonistin, die zwischen den einzeln verhallenden Tönen den meisten Raum einnimmt. Natürlich, wie kann es anders sein, klingelt genau in diesem andächtigen Moment das erste Mobiltelefon des Festivals, dessen – sich fleißig im Manspreading übender – Besitzer sich davon jedoch nicht sonderlich aus der selbstgefälligen Ruhe bringen lässt. Wo andere längst peinlich berührt aus dem Saal geflohen wären, kramt er umständlich und in aller Seelenruhe in seinem sperrigen Rucksack herum. Es ist immer wieder erstaunlich, wie zielgenau sich schlechte Manieren mit unerschütterlichem Selbstvertrauen paaren!

Debacker antwortet mit dem aus tiefsten Tiefen aufsteigenden Gegroll eines plötzlich hereinbrechenden Unwetters und beendet ihr abenderöffnendes, eher auf die Endzeit als auf weitere Konzerte einstimmendes, schlechterdings beeindruckendes Set auf einem einzigen, minutenlang gehämmerten Ton, der in den Ohren klingt. Während sie noch den ihr gebührenden Applaus entgegennimmt, rollen beflissene Stage Hands den Flügel von der Bühne, auf welcher schon die sieben Musiker*innen der Deutschlandpremiere „I Get Along With You Very Well“ Platz nehmen, einem Duo-Projekt voller düsterer Break-up Songs der aus Schweden stammenden, Wahl-Berliner Sängerin und Trompeterin Ellen Arkbro und des Pianisten Johan Graden. Ich glaube, neben dem Kontrabassisten Petter Eldh, der auf dem letzten Jazzfest mit seinen Instrumentengenossen Ingebrigt Håker Flaten und Ole Morten Vågan eine wahre Tieftonfront bildete, auch die Posaunistin Nabou Claerhout zu erkennen, die uns schon im April auf der Bühne von Stéphane Scharlés OZMA & Friends auf der Berthold Records Clubnight im Rahmen der jazzahead! begeistert hat. Freude!
Als bekennende Freundin der Nachtseiten der Musik habe ich den Break-up Songs ohnehin die größte Vorfreude des gesamten Festivalprogramms entgegengebracht. Zu Recht, denn es ist ein Erlebnis, wie sich dieses Semi-Large Ensemble ganz reduzierte Düsternuancen abtrotzt, bis man gar nicht mehr weiß, was man schöner finden soll: Ellen Arkbros spröden Gesang oder die Momente, wo sie zur Trompete greift und sich harmonisch in den getragenen Bläsersatz einfügt, dessen Klang von Claerhouts Posaune klar dominiert wird und gemeinsam mit der sie sekundierenden Bassklarinette trauermarschartige Soundgebilde absondert. In meinen Konzertnotizen steht dazu nur: „Ach! Irgendwie ist das gar magisch! Und all-in-all ganz phantastisch!“ Klar, dass ich Ihnen ein Video hiervon nicht vorenthalten will. Für den wackeligen Moment darin entschuldige ich mich: Der Manspreader pochte unter wenig Rücksichtnahme, dafür aber vollem Körpereinsatz auf sein Recht auf die Hälfte der gemeinsamen Armlehne.
Reduzierte Düsternuancen: die Break-up Songs von Ellen Arkbro und Johan Graden, hier: „Out of Luck“
Als ich in der gestrigen Pause das Kürbis-Süppchen für fruchtig befand, wusste ich nicht nichts von der heutigen Tomatensuppe. Die ist erstmal fruchtig! Während ich beseelt löffle, vernehme ich hinter mir Konzertkritik. Das Wort „schlaftablettenmäßig“ fällt, und im gleichen Atemzuge wird über die Festivalleitung gelästert. „Geht ja gar nicht“ ist eine oft bemühte Phrase in dem Gespräch. Ich drehe mich um und finde meine Vermutung bestätigt: Da ergehen sich ein paar Gestrige in ihrem gefühlten (und bewusst zelebrierten) Abgehängtsein, die nicht nur die Tiefe von düsteren Darbietungen nicht zu erfassen in der Lage sind und sie vielmehr für „tranig“ und „blutarm“ halten, weil sie lediglich Highspeed-Gegniedel, bei dem es darum geht, technische Virtuosität zu zelebrieren, als echten Jazz gelten lassen – sondern die auch den richtigen Zeitpunkt zum eleganten Aufhören verpasst haben und obendrein ob der Tatsache verschnupft sind, dass ihre Zeit im Zenit der Macht unwiederbringlich abgelaufen ist und keiner mehr ihre sich hinter vorgeblicher Expertise verschanzenden, unsympathischen Boshaftigkeiten lesen will, die nicht mal besonders gut geschrieben sind.
Generell wird viel gelästert im Jazz. Von außen wirkt die Jazzwelt immer wie eine vornehme Szene, wo distinguierte Menschen mit Kennermiene ihre Rotweinkelche schwenken und wohlbedachte Meinungen in druckreifem Wortlaut äußern, kurz: zwar elitär, aber zu wohlerzogen für Klatsch und Tratsch sind. Tatsächlich gehen andere Szenen freundlicher miteinander um. Was umso bedauerlicher ist, als dass der sprichwörtliche Kuchen, den man zu verteilen hat, im Jazz schon immer winzig war –und jetzt spürbar noch kleiner geworden ist und sogar weiter schrumpfen soll. Da kann man sich doch für jede und jeden freuen, die oder der etwas davon abbekommt, anstatt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen!

Jetzt aber ist es erst einmal Zeit für die Live-Übertragung – und zwar einer weiteren Weltpremiere. In dieser trifft der legendäre Chicagoer Saxophonist Henry Threadgill mit samt Band auf seine deutsche Instrumentalkollegin Silke Eberhard und ihr mit dem Deutschen Jazzpreis 2023 ausgezeichnetes Ensemble Potsa Lotsa XL. Eberhard hatte Threadgills Kompositionen 2020 während der Pandemie für das Jazzfest Berlin arrangiert und aufgeführt. Von dem Mitschnitt war der US-Amerikaner, der pandemiebedingt bei der Aufführung nicht anwesend sein konnte, so begeistert, dass er beschloss, eigens für Eberhards zehn Mann starken Trupp und sein fünf-köpfiges Ensemble Zooid neue Musik zu komponieren. Herausgekommen ist „Simply Existing Surface“, dessen Partitur mit neuen Taktarten in fast jedem Takt und rätselhaften Zahlenkolonnen à la „2+253-7“ (übersetzt: Sekunde, Sekunde, Quinte, Terz, Septime, während plus und minus für großes bzw. kleines Intervall stehen) verstört. Unter dem Dirigat Silke Langes sowie mit über sich selbst hinauswachsenden Musikern (dieses phantastisch-irrsinnige Kontrabasssolo!) lichtet sich dann aber das hochkomplexe Kompositionsdickicht; und nach knapp fünfzig Minuten beginnt auch Threadgill richtig zu spielen, sodass man schlagartig realisiert, weshalb das hier seine Musik ist, sein Publikum, seine Bühne.
Wieder ist einer der Momente erreicht, wo man nur noch nach Hause gehen möchte, um das soeben Erlebte emotional und intellektuell zu genießen und zu verarbeiten. Doch auf der Seitenbühne lockten die Irreversible Entanglements, ein amerikanisches Free-Jazz-Kollektiv mit Spoken Word-Performerin Camae Ayewa aka Moor Mother, die das Material ihres neuen Albums „Protect Your Light“ vorstellen. Muss man gesehen haben, klar. Da der Festivalsonntag aber schon um elf Uhr in der Früh mit der Deutschlandpremiere des Tilman-Urbach-Films „Tastenarbeiter“ lockt, einer Dokumentation über Alexander von Schlippenbach, sollte man gleichzeitig zusehen, wenigstens einige Stunden Schlaf zu bekommen. Schließlich wohnt nicht jeder in Charlottenburg-Wilmersdorf; viele müssen innerhalb der Stadt eine knappe Stunde an- und abreisen.

Die Logistik ist auch am Sonntag ein Problem für Nord- und Ostberliner und alle, deren Hotelzimmer dort stehen. Nach dem Film hätte man Leerlauf, zu lang, sich vor Ort aufzuhalten, zu kurz, um nach Hause bzw. ins Hotel und wieder zurückzufahren, bis um 15:00 Uhr die Gedächtniskirche ihre Pforten für das Projekt „Ghosted“ des Trios Ambarchi/Berthling/Werliin und damit eine weitere Deutschlandpremiere öffnet. Klar kann man draußen rumlaufen, ob zum Sight Seeing oder zum Window Shopping, was bei der Nässe allerdings wohl die wenigsten tun werden. Klar kann man auch lunchen gehen oder ins Museum oder womit auch immer das alte West-Berlin am Sonntag indoors lockt. Mit allem wird man sich, das kann ich garantieren, aus dem Festival-Groove hinauskatapultieren. Da bietet sich noch am ehesten an, bei der Verleihung des Albert-Mangelsdorff-Preises dabei sein, der diesjahr an den Posaunisten Konrad „Conny“ Bauer geht.
Das Abendprogramm wird wieder straff: Schon um 17:00 Uhr wartet auf der Großen Bühne des Festspielhauses das Duo McHenry/Cyrille mit „Proximity“, an das sich die Performance „Eurythmia“ von Eve Risser’s Red Desert Orchestra anschließt. Hier spürt die französische Pianistin den musikalischen und vor allem rhythmischen Texturen Westafrikas nach. Nach einer kurzen Pause beginnt auch schon das Preisträgerkonzert von Conny Bauer, der im Trio mit dem Kontrabassisten William Parker und dem Schlagzeuger Hamid Drake, der bei der letztjährigen Ausgabe des Jazzfestes mit dem kürzlich verstorbenen Peter Brötzmann auf der Bühne stand, spielt. Mit einem „Natureza“ getauften Rückblick auf ihr Lebenswerk beschließt die brasilianische Sängerin Joyce Moreno das Festival so unaufgeregt und unspektakulär, wie es begonnen hat. Die diesjährige Festivaldramaturgie gleicht einer Sinuskurve, die sich langsam aufbaut, ihren Höhepunkt erreicht und genauso langsam wieder abflacht. Über 7.000 Zuschauer*innen waren inklusive der Satellitenspielstätten dabei.

Save the date: Das nächste Jazzfest Berlin findet vom 31. Oktober bis 3. November 2024 statt.



