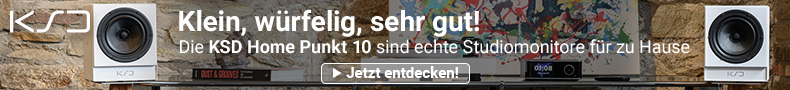Im Sommer 2020 hatte ich mich dazu entschlossen eigene Lautsprecherständer zu bauen. DIY – oder do-it-yourself, wie man neudeutsch sagt. Ausgangspunkt war das sandgefüllte Aluminium-Rohr, das ich mit den entsprechenden Gewinden eigentlich für das KM-Design Stativ hatte anfertigen lassen. Das hervorragend verarbeitete, höhenverstellbare Originalrohr von KM kam mir doch etwas zu technisch und optisch unruhig für mein Hörzimmer daher. Das KM-Stativ trug die GENELEC Plattform und die 8260 die darauf standen. Mit den Dutch&Dutch 8c wich die maßgeschneiderte GENELEC-Plattform dann einer 30 mm Multiplex-Platte – aber immer noch mit dem gusseisernen KM-Stativfuß. Mit der Veräußerung der GENELEC 8260 wollte ich nun auch das Stativ komplett abgeben, damit ein schönes Gesamtpaket entsteht. Lange Rede, kurzer Sinn: das maßgefertigte Rohr samt Multiplex-Plattform blieb übrig. An das neue Stativ gehörte ein Knopf gemacht. Ein neuer Fuß musste her.
 Und dieser Knopf stellte sich als 50 mm Multiplex-Buchenplatte mit dem Grundriss des KM-Fußes dar. 50 mm Plattenstärke ist zwar abseits der gängigen Baumarkt-Maße, aber nach etwas Recherche in online-Baumärkten dann doch als Zuschnitt im Versand erhältlich. Schließlich habe ich ein Auge für Linien, und die Plattenstärke ergibt zusammen mit der quadratischen Fläche eine schöne Proportion. Meine Überlegung war, durch die Plattenstärke eine hohe Steifigkeit zu erzeugen und gleichzeitig die Dämpfungseigenschaften des Holzes zu nutzen. Vorteil des Holzes im Selbstbau ist, dass man selbst mit einfachen Mitteln Rampa-Gewindemuffen einbringen kann, um beispielsweise Lautsprecherfüße oder Spitzen einzuschrauben. Die Idee kam mir, weil ich so schon mein Möbelhaus-HiFi-Möbel (DIY-Praxis-Tipp) mit bfly-Audio Talis Lautsprecherfüßen ausgestattet hatte.
Und dieser Knopf stellte sich als 50 mm Multiplex-Buchenplatte mit dem Grundriss des KM-Fußes dar. 50 mm Plattenstärke ist zwar abseits der gängigen Baumarkt-Maße, aber nach etwas Recherche in online-Baumärkten dann doch als Zuschnitt im Versand erhältlich. Schließlich habe ich ein Auge für Linien, und die Plattenstärke ergibt zusammen mit der quadratischen Fläche eine schöne Proportion. Meine Überlegung war, durch die Plattenstärke eine hohe Steifigkeit zu erzeugen und gleichzeitig die Dämpfungseigenschaften des Holzes zu nutzen. Vorteil des Holzes im Selbstbau ist, dass man selbst mit einfachen Mitteln Rampa-Gewindemuffen einbringen kann, um beispielsweise Lautsprecherfüße oder Spitzen einzuschrauben. Die Idee kam mir, weil ich so schon mein Möbelhaus-HiFi-Möbel (DIY-Praxis-Tipp) mit bfly-Audio Talis Lautsprecherfüßen ausgestattet hatte.
 Neben den positiven akustischen Eigenschaften der Lautsprecherfüße ist ein weiterer großer Vorteil die Höhennivellierung durch das Schraubgewinde. Es wackelt also nichts. Etwas tricky ist übrigens die Einbringung der Bohrungen in die Bodenplatte und die Lautsprecher-Plattform. Hier sollte man hinreichend Spiel zur Schraube vorsehen, damit man die Platten zueinander einstellen kann – oder man steckt Aufwand oder Gehirnschmalz in die Erhöhung der Fertigungstoleranzen.
Neben den positiven akustischen Eigenschaften der Lautsprecherfüße ist ein weiterer großer Vorteil die Höhennivellierung durch das Schraubgewinde. Es wackelt also nichts. Etwas tricky ist übrigens die Einbringung der Bohrungen in die Bodenplatte und die Lautsprecher-Plattform. Hier sollte man hinreichend Spiel zur Schraube vorsehen, damit man die Platten zueinander einstellen kann – oder man steckt Aufwand oder Gehirnschmalz in die Erhöhung der Fertigungstoleranzen.
Den Lautsprecherständer habe ich initial mit den unbehandelten Multiplex-Platten zusammengebaut. Dabei hat sich gezeigt, dass es großen Sinn macht, den Lautsprecherständer über mehrere Monate eben so einzuspielen. Viele mögen sagen, ohne sicher zu stellen, dass das Rohmaterial in einer Vollmondnacht bei Sommersonnenwende geschnitten wurde, sei der Aufwand vollkommen unsinnig. Aber das halte ich für polemischen Unsinn. Tatsächlich wichtig ist, dass der Lautsprecherständer mit dem unbehandelten Holz spätestens zum Spätsommer in Betrieb geht, da das warme Wetter und die relativ hohe Luftfeuchtigkeit (relativ wie absolut) Einfluss auf das Gefüge des Holzes hat.
Auch wenn es sich bei Multiplex bei weitem um keine offenporige und schwache Struktur handelt interagiert das Gefüge des Holzes mit den sich ändernden Umgebungsbedingungen. Die sommerlichen Temperaturschwankungen, die über dem Heizniveau der kalten Jahreszeit liegen, sinken im Laufe des Winters auf ein relativ gleichmäßiges Heizungsklima ab. Gleichzeitig sinkt die absolute Luftfeuchte der Außenluft und damit recht deutlich die relative Luftfeuchte im beheizten Raum.
 Mit dem Betrieb der Lautsprecher wird der Lautsprecherständer dann in axialer Richtung angeregt. Aber im Fuß auch mit einem Moment, das durch die Membranimpulse der Lautsprecher ausgelöst wird. Die dreidimensionalen Anregungen finden im Frequenzspektrum der Musik statt und sind gemessen an Dimension und Material somit eher hochfrequent. Dieser dynamische Effekt interagiert offensichtlich mit dem thermischen Effekt, der auch auf den ruhenden Lautsprecherständer einwirkt. Diese Wirkkombination nimmt Einfluss auf die Mikrostruktur des Multiplexholzes, das sich durch eine gleichmäßige Verdichtung (Mikrokompression) insbesondere der Fußplatte bemerkbar macht.
Mit dem Betrieb der Lautsprecher wird der Lautsprecherständer dann in axialer Richtung angeregt. Aber im Fuß auch mit einem Moment, das durch die Membranimpulse der Lautsprecher ausgelöst wird. Die dreidimensionalen Anregungen finden im Frequenzspektrum der Musik statt und sind gemessen an Dimension und Material somit eher hochfrequent. Dieser dynamische Effekt interagiert offensichtlich mit dem thermischen Effekt, der auch auf den ruhenden Lautsprecherständer einwirkt. Diese Wirkkombination nimmt Einfluss auf die Mikrostruktur des Multiplexholzes, das sich durch eine gleichmäßige Verdichtung (Mikrokompression) insbesondere der Fußplatte bemerkbar macht.
Die unversiegelte Oberfläche des Holzes beeinflusst diesen Effekt positiv oder ermöglicht ihn gar erst, da so keine Trennschicht zur Umgebungsluft besteht. Um den Effekt der Mikrokompression zu konservieren, muss dann das Holz des Lautsprecherständers nach Abschluss der Einspielzeit (der Hörer bemerkt es gut an der Stagnation des mikrodynamischen akustischen Effektes, der dem Klang erstaunlich sphärische Züge verleiht) komplett (nicht bei der Unterseite schummeln, sonst greift der konservierende Effekt nicht vollständig) mit einem hochwertigen Öl in mehreren Schichten (Gebrauchsanleitung beachten!) versiegelt werden. Wichtig ist, dass die Versiegelung bis zum Frühlingsäquinoktium stattfindet, da die sich ändernden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit einen reversiblen Einfluss auf die Mikrostruktur des Holzes haben und die so Mikrokompression zumindest teilweise aufgehoben wird. Als allerletzten Stichtag sollte sich der Hobby-Lautsprecherständer-Bauer den 2. April vormerken, da spätestens zu diesem Datum der Spaß mit der dynamisch-thermischen Mikrokompression vorbei ist.

Anbei ein paar Fotos von meinen Lautsprecherständern, die mir beim Bau viel Freude bereitet haben und im Betrieb immer noch bereiten. Die Einspielzeit und die feine Ölung dankt er mir jedenfalls mit geschmeidigem Glanz und schöner Griffigkeit nicht nur im Sound. Solltet ihr euch auch an an DIY-Projekt wagen: Viel Spaß dabei – und alles nicht zu Bierernst nehmen 😉
[Anmerkung von Falk am 24.04.2021: Wahrscheinlich habt ihr es bemerkt. Das Einspielen der Lautsprecherständer und die dazugehörige Theorie war ein kleiner April-Scherz von uns. Den konnten wir uns nicht verkneifen. Das Bauen hat viel Freude bereitet und es ist ja auch schön, was Selbstgemachtes anschauen zu können. Ungeölt haben die Ständer tatsächlich einige Monate gespielt – was aber eher an meinem mangelnden handwerklichen Enthusiasmus gelegen hat, als am akustischen Kalkül. Und was die Klangveränderung angeht… nun ja, da bin ich mir nicht ganz sicher 😉 ]
Fotos: F. Visarius