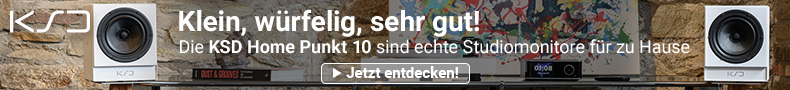Das gewisse Vielleicht
Max Andrzejewski’s Hütte | Reduce
(Label: Fun in the church)
Der umtriebige Berliner Drummer Max Andrzejewski ist treuen HiFi-IFAs-Lesern bereits von einigen seiner schönen side projects bekannt. So rührt er nicht nur beim Duo Training, das dieses Jahr mit der Bassistin, Sängerin, Komponistin und Aktivistin Ruth Goller eine weitere Platte aufgenommen hat, oder der Surf-Supergroup Expressway Sketches um Gitarrist Tobias Hoffmann das Schlagwerk, sondern vor allem auch bei seiner eigenen Band Hütte. Deren selbstbetiteltes Debüt, für welches es den Neuen Deutschen Jazzpreis gab, sorgte 2012 für mindestens ebensoviel Kritikerlob wie die Nachfolgealben Hütte und Chor (2014), Hütte and The Homegrown Organic Gospel Choir (2017) und Hütte & guests play the music of Robert Wyatt (2019).

So etwa notierte der Berliner Kritiker Wolf Kampmann, kaum eine andere junge Jazzband hätte in den letzten Jahren in Deutschland so viel Aufsehen erregt wie diese Formation. Ich selbst hielt zum letzten Hütte-Album in meiner nach 55 Ausgaben freiwillig und in Ehren zu Grabe getragenen Kolumne Szirmais Fermaten für die 2019er November-Dezember-Ausgabe des Jazzthetik Magazins fest: „Neben der unter anderem mit Johannes Schleiermacher am Saxophon und Andreas Lang am Bass besetzten Kernformation sowie Gast-Organist Jörg Hochapfel hat der Drummer mit Cansu Tanrıkulu eine Vokalistin gefunden, die sich ganz im Wyatt’schen Sinne durch die Oktaven jault, kiekst, tremoliert, kurzum: alles tut, um ja nicht Gefahr zu laufen, auch nur ansatzweise für gefällig befunden zu werden, kräftig sekundiert von ihren unbequem-experimentierwütigen Mitstreitern.“
Dieser Herangehensweise bleibt das aktuelle Album Reduce – das zum einen so heißt, weil Hütte hier zur Ausgangsformation, dem (neben Andrzejewski an den Drums mit Johannes Schleiermacher am Saxophon, Tobias Hoffmann an der Gitarre und Andreas Lang am Bass besetzten) Quartett, zurückkehrt, zum anderen, weil wir unseren Ressourcenverbrauch dringend zurückschrauben müssen, wenn das mit dieser Welt noch mal was werden soll – nur ansatzweise treu. Die Kompositionen Andrzejewskis nämlich geben sich hier weniger unbequem als sperrig-schön, zart suchend, ja: filigran – und erstaunlich warm und organisch, was beim Opener „Fließen“ vor allem an den Vintage-Sounds Hoffmanns und den Luft und Leben atmenden Tönen Schleiermachers liegt, die in einem mal reduzierten (Bass), mal verzwackten (Drums) Klangbett der „Rhythmusgruppe“ ihre Persönlichkeit entfalten. Ja, auch hier wird es nach knapp zwei Minuten sehr freejazzig – dabei aber nie anstrengend. Neben anheimelnder Wärme und luftiger Leichtigkeit bleibt diese Musik immer im positivsten aller Sinne: angenehm. Sie kitzelt den Intellekt, ohne auf körperliches Wohl zu verzichten.

Die Single „Risse“, die Andrzejewski ursprünglich für ein zeitgenössisches Ensemble von Flöte, Bratsche, zwei Gitarren und Kontrabass geschrieben hat, ist mit ihrem Spiel mit kopfverdrehenden Stereoeffekten ganz dem Zwischenraum, dem Schwebezustand gewidmet – diesem gewissen Vielleicht, das für viele so schwer fass- und aushaltbar ist. Hier lernt man, das Unbestimmte, das sich noch in jedwede Richtung entwickeln kann, zu genießen. „Rose“ lockt dann mit heiserem Bläseratem in ferne Länder – ja, warum eigentlich nicht auf bulgarische Rosenfelder, die ihren betörenden Duft flutartig verströmen, wenn ein Wind durch sie fährt, während „Gemini“ die Zweigesichtigkeit ein und derselben Sache, die jedem Ding innewohnende Ambivalenz, mittels sich im Freien verlierender Figuren über bittersüßer Harmonie, mittels komponiertem Thema und spontaner Improvisation aufzuzeigen versteht.
Behutsam pirscht sich „Lylan I“ mit so spröden wie exquisiten Minimalgitarrentönen an, die dem Instrument ohrenscheinlich nicht an der vorgesehenen Stelle entlockt werden, um in einem zunehmend schleppenden Groove seine Leichtigkeit gegen eine unbestimmte Schwere einzutauschen, deren Gewicht erst von dem mit sehr freien Saxophonparts über feinziseliert-vertrackt klackerndem Rhythmuswerk wieder aufgehoben wird. Egal, wie frei sich die Stücke von Reduce auch gebärden – immer eignet ihnen eine gewisse Schwerelosigkeit, die dafür sorgt, dass sie selbst dem Freejazz-ungeübten Hörer nie allzu mühsam werden. Das ventilgeklapperreiche „Degeneration“, das in einen tagtraumanregenden Loop mitnimmt, ist gen Ende sogar dazu angetan, auch diesem Publikum zum vertrauten Wiegenlied, das ob einer ihm unterschwellig innewohnenden spookiness nur ein winziges bisschen unkomfortabel ist, zu werden.
Experimenteller zeigen sich die „Ränder“, denen man richtiggehend beim Ausfransen zuhören kann. Allerlei Übermäßiges sorgt für einen Aufmerksamkeitsschub, der wie’s scheint dafür genutzt wird, die Zugbrücken hochzuziehen, um sich vor einer Selbstveräußerung, einer Eigengrenzübertretung, gar einem Zerfließen zu bewahren. Entschiedene Akzente unter reichlich Trommelwirbel setzt auch „Sparkle, Madly“, das undurchdringlich dunkel funkelt, kurz aber intensiv, wohingegen das gitarrendominierte „Lylan II“ als zarte Reprise dem bisherigen Schwebezustand eine weitere Steigerung hinsichtlich Leichtigkeit, Schwerfassbarkeit und detailverliebter Eleganz, zusammengehalten von tiefgründigem Intellekt und dem unbedingten Willen zu einer Ästhetik, die vom Reduzierten lebt, angedeihen lässt. Heraus kommt eine Platte, komplex, von mir aus auch: kompliziert, ohne jemals schwierig zu sein.
P.S.: Reduce gibt es, umweltschonend ausschließlich digital, auch auf der künstlerfreundlichen Plattform Bandcamp. Wer dort kauft, erhält mit dem Download-Code ein super-limitiertes, hand-nummeriertes Siebdruckposter des Berliner Künstlers Moritz Borchard dazu, das sich, wer mag, in die eigene Hütte hängen kann.